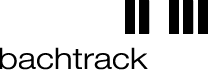Für eine letzte Vorstellungsserie holt Lohengrin an der Wiener Staatsoper den Lodenjanker aus dem Schrank, bevor in der kommenden Saison eine Inszenierung, die schon bei den Osterfestspielen in Salzburg 2022 zu sehen war, im Haus am Ring übernommen wird. Wirklich warm geworden ist das Wiener Publikum mit der Inszenierung von Andreas Homoki in den vergangenen Jahren allerdings ohnehin nicht, wobei sich mir doch immer die Frage stellt, woran das eigentlich lag.
Denn die Inszenierung ist mangels allzu ausgeflippter Ideen auch in einem Repertoirebetrieb mit kurzfristigen Einspringern praktikabel und beleidigt in ihrer Trachten-Dorfgasthaus-Ästhetik wahrlich kein Auge. Darüber hinaus ergibt die Verlegung in ein Dorf mit rivalisierenden, alteingesessenen Familien, bigotter Frömmigkeit und dem Glauben an Wunder sowie einer Abneigung gegen unbekannte Fremde auch inhaltlich durchaus Sinn: In wohl jedem kleinen Ort (auch in der heutigen Zeit!) käme es zu allerhand Intrigen, Gerüchten und Verleumdungen, wenn die Dorfschönheit dem Bürgermeister den Brautstrauß vor die Füße wirft und nach dem unerklärlichen Verschwinden ihres Bruders plötzlich einen Mann heiraten will, über dessen Herkunft und Vergangenheit niemand etwas weiß.
Der Papierform nach hätte dieser Abend eine Sternstunde werden können, tatsächlich überzeugte aber nur Piotr Beczała in der Titelpartie auf ganzer Linie. Obwohl er nicht über einen metallischen Heldentenor-Kern in der Stimme verfügt, ist sein Timbre für den Schwanenritter geradezu ideal und verströmte vom ersten Ton an eine mystisch-entrücket Aura. Hinzu kam die traumwandlerische Sicherheit in Bezug auf all die technischen Anforderungen der Partie: egal ob strahlendes Forte im Gottesgericht, zurückgenommenes Pianissimo bei der Gralserzählung (für einen Moment hielten hier beim Wort „Taube” sogar die hartnäckigsten Huster im Publikum andächtig die Luft an) oder lange Legatobögen – für Beczała scheinbar keine Herausforderung. Während es Camilla Nylunds Sopran phasenweise an Volumen und Substanz mangelte, bestach ihre Stimme in den zarten Passagen dafür umso mehr mit warmem Klang und eleganter Reinheit des Tons, wodurch sie den bis zur Naivität unerschütterlich optimistischen Charakter der Elsa betonte. Zu einem Höhepunkt des Abends wurde dadurch auch „Das süße Lied verhallt”, wobei sich die Stimmen von Beczała und Nylund wunderbar sanft verbanden und silbrig glänzend die Hoffnung auf ein Happy End der Geschichte weckten.
Für Nina Stemme bedeutete ihre jahrelange Wagnererfahrung an diesem Abend gewissermaßen Fluch und Segen. Denn einerseits profitierte sie natürlich von ihrer Routine und brachte eine dreidimensionale Figur auf die Bühne, der sie sowohl mit vielschichtigen Farben in der Stimme als auch mit einnehmender Bühnenpräsenz Facettenreichtum verlieh; andererseits kann ihre Interpretation der Ortrud im Vergleich nicht mit ihren – mittlerweile zurückgelegten – Paraderollen Isolde und Brünnhilde mithalten. Auch haben die dramatischen Partien der Vergangenheit merklich Spuren an ihrem Sopran hinterlassen, einige Spitzentöne gerieten beinahe schrill und die Stimme wirkte zuweilen deutlich angestrengter, als man es von ihr gewohnt war. Tomasz Konieczny polterte als Telramund energisch drauflos und zeichnete die Figur mit schier endloser stimmlicher Kraft als beleidigten Macho. Sein Bariton hat mit der zuweilen hoch angesetzten Tessitura der Partie keinerlei Probleme, die Höhen gelangen ebenso strahlend wie die Tiefen dunkel brodelten. Das Manko seiner Interpretation blieben allerdings mangelnde Wortdeutlichkeit und eine Einheitsemotionsklangfarbe; dass es sich eigentlich um einen zerrissenen Charakter handelt, erschloss sich daher nur bedingt. Clemens Unterreiner konnte sich zwar auch als würdevoller Heerrufer sein typisch exaltiertes Spiel nicht ganz verkneifen, bot aber eine exzellente stimmliche Leistung mit fließendem Ton und karamelligem Timbre. Tareq Nazmi wirkte als König Heinrich darstellerisch hingegen reichlich unauffällig und vermochte es auch nicht so recht, ehrfurchtgebietend zu klingen, obwohl sein Bass mit satter Tiefe ausgestattet ist.
Am Dirigat von Omer Meir Wellber schieden sich hörbar die Geister – so mischten sich bereits nach dem ersten Aufzug sowohl viele Bravo- als auch vereinzelte Buh-Rufe in den Applaus. Seine Interpretation der Partitur war, neben einigen Abstimmungsproblemen mit dem Staatsopernorchester, auch wirklich eine Geschmacksfrage, denn er setzte ab dem ersten Ton des Vorspiels auf zupackendes Drängen und irdische Schwere. Darüber hinaus reizte er sowohl Dynamik als auch Tempo zuweilen bis an die oberste Grenze aus, wodurch aus der romantischen eher eine forsche Oper wurde. Ich persönlich hätte mir etwa im ersten Aufzug viel mehr verklärte, überirdisch-entrückte Momente voll silbrigem Schwirren gewünscht, wodurch auch der Kontrast zu den brodelnden Klangwelten des zweiten Aufzugs stärker gegeben gewesen wäre. Allerdings ist das Staatsopernorchester per se eine sichere Bank und bot auch an diesem Abend nach anfänglichen Unsauberkeiten durchaus hohe Qualität – etwa in Form des farbenreichen Streicherklangs und elegant phrasierten Holzbläsern – wenn auch der Dirigent keinesfalls das Maximum aus dem Klangkörper herauszuholen vermochte. Dass die Abstimmung zwischen Orchester und Bühne einwandfrei funktionierte, schien überdies der Verdienst eines Mannes im Hintergrund gewesen zu sein, denn die Koordination der Sänger überließ Meir Wellber an diesem Abend auffallend oft dem Maestro suggeritore. So viele aus der Box gegebene und dabei für das Publikum deutlich zu sehende Einsätze sind selbst angesichts der an der Staatsoper traditionell kurzen Probezeiten für Repertoirevorstellungen selten.