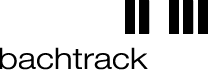Klaus Mäkelä ist der Shootingstar unter den Dirigent*innen. Derzeit Chef in Oslo und Paris, demnächst auch beim Concertgebouworkest in Amsterdam. Mit den Niederländern trat der 27-Jährige im vergangenen Jahr das erste Mal im Rahmen des Musikfests in der Berliner Philharmonie auf, jetzt steht er erstmals mit den Hausherren selbst auf der Bühne. Am Ende des Abends stehen jedoch mehr Fragen als Antworten. Zwar schafft Mäkelä viele hörenswerte Einzelmomente, bietet jedoch Interpretationen ohne Ecken und Kanten.
Eines muss man dem finnischen Jungstar dabei schon vor dem Erklingen des ersten Tons zu Gute halten: Angst vor dem Vergleich scheint Mäkelä nicht zu scheuen. So steht Tschaikowskys Symphonie Nr. 6 bei seinem Berliner Philharmoniker-Debüt auf dem Programm. Wählen andere Dirigent*innen unbekanntere Werke für ihren Start bei großen Orchestern, ist es bei Mäkelä eine der großen Symphonien der Konzertliteratur. In den letzten elf Jahren haben keine Geringeren als Christian Thielemann, Daniel Barenboim, Manfred Honeck und zuletzt Kirill Petrenko, bei seinem umjubelten ersten Konzert nach der Wahl zum Chefdirigenten, die Pathétique interpretiert. Ihr voran steht in dieser Woche eine andere sechste Symphonie, jene aus der Feder von Dmitri Schostakowitsch. Beide in h-Moll geschrieben, beginnt Schostakowitschs Werk dort wo Tschaikowskys endet: mit einem scheinbar endlosen langsamen Satz.
Kraftvoll mit hell-gleißendem Streicherklang startet Mäkelä in den Abend. Klar und transparent ist seine Interpretation von Schostakowitschs dreisätziger Symphonie. Wenig Klagegesang, keine Bedrohlichkeit, kaum karikative Hysterie zum Ende – zwar schafft Mäkelä eine klangreiche Atmosphäre, kreiert ein weiches Bett, um die zahlreichen Instrumentalsoli glänzen zu lassen, doch geht dabei vor allem im ersten Satz immer wieder der unbedingte Vorwärtsdrang verloren. Agil und mit vollen Körpereinsatz versucht der finnische Dirigent die vor ihm sitzenden Philharmoniker zu animieren, doch wenden sich die Augen der Musiker*innen nur selten gen Dirigentenpult. Wenig Interaktion ist die Folge, Mäkeläs bestimmend-detailversessene Gesten verlaufen klanglich allzu häufig im Nichts. So wirkt Schostakowitschs Symphonie am Ende steril, in geheimnisloser Streicherbrillanz erschöpft.
Leichtgewichtig kommt auch die Pathétique nach der Pause daher. Allzu häufig extrem bedeutungsschwanger be- bis überladen, klingt das zunächst erfrischend anders. Mäkelä wählt zu Beginn des ersten Satzes ein eher gemächliches Tempo, lässt viele Details hörbar werden. Dabei kann der Dirigent seine Herkunft als Cellist in vielen Momenten nicht verbergen, gerne badet er im kraftvollen Streicherklang des Orchesters, wird aber nie übermäßig schwelgerisch. Allerdings droht so manches Detail darüber eher verschleiert als herausgearbeitet zu werden, denn nicht in allen Momenten wirkt die Abstimmung zu den anderen Orchestergruppen ausgeglichen. Klanglich erinnert der Kopfsatz eher an eine Naturbetrachtung denn dem Ringen des Individuums mit dem Schmerz der Welt, so kommt auch der berühmte Tuttischlag auf eher sanften Sohlen daher.
Spielerische Leichtigkeit ist auch das Motto der folgenden Sätze. Ohne Taktstock und mit zurückhaltenden Gesten formt Mäkelä das Allegro con grazia, ehe er im Allegro molto vivace die Zügel auch im Tempo anzieht. Zahlreiche Details blitzen auf, größtenteils große Akkuratesse aber weiterhin wenig Spielfreude breiten sich aus. Dennoch wissen die Musiker*innen dieses Weltklasseorchesters in den Soli-Passagen (allen voran Wenzel Fuchs an der Klarinette) und den großen Tutti-Momenten zu glänzen. So entstehen wie schon zuvor zahlreiche spannungsvolle Einzelmomente, doch die großen, fein-abgestimmten Gänsehauthöhepunkte folgen nicht. Verblüffend leicht und leuchtend-deutlich klingt Tschaikowsky an diesem Abend, das geht jedoch auf Kosten der musikalischen Dramatik und interpretatorischen Dringlichkeit. Was will uns der Komponist, der Dirigent sagen? Eine Retrospektive auf das Leben, das Aufbäumen gegen den Tod, der Abschied von der Welt – das alles bleibt an diesem Abend sehr gleichförmig und wirkt, trotz aller Brillanz, emotionslos neutral.
Hatte es vor der Pause noch lautstarke Bravo-Bekundungen des Publikums gegeben, ist der Jubel nach der Pathétique dann zurückhaltender, auch wenn ein harter Kern den Dirigenten noch einmal durch erneuten Applaus auf die Bühne bittet. Am Ende bleibt zu erinnern: Auch wenn Mäkelä in aller Munde und auf vielen Podien zu finden ist, steht hier ein junger Dirigent am Anfang seiner Karriere auf der Bühne. Ihm bleibt viel Zeit, an seinen Interpretationen zu feilen, nicht alles muss beim ersten Mal sitzen. Es wird spannend sein, seine weitere Entwicklung zu beobachten, hoffentlich auch wieder in Berlin.