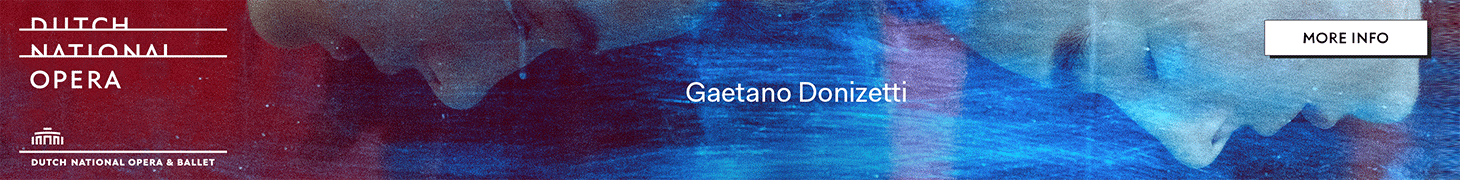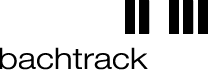Der Regisseur Claus Guth und Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, Sebastian Weigle, sind beide erfahren im Umgang und der Interpretation der Opern von Richard Strauss. Letzterer ist nunmehr seit 15 Spielzeiten Leiter des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters und übernimmt mit Elektra seine letzte Neuproduktion am Haus. Es ist Weigles Abschied, aber ebenso auch eine Möglichkeit, ein letztes Mal aufzutrumpfen.
In einem großen Flur, dessen Interieur alles vom eleganten Kurhotel bis hin zu einer Nervenheilanstalt für Besserverdienende sein könnte, eröffnet die Oper. Die Wände sind von violettfarbenen Vorhängen verhüllt und von Notausgängen gesäumt – dennoch scheint es keinen Ausweg zu geben. Dieses dysfunktionale Gebäude spiegelt nur zu gut die Befindlichkeiten und Beziehungen seiner Bewohner*innen wider, ist voller Gewalt und Aggression. Die 100 Minuten der Oper fühlen sich an wie ein Gefangensein im sich stetig verändernden Labyrinth dieses Hauses – einer Art Limbo, bei dem es kein Vor und Zurück gibt. Innerhalb dieser Gesellschaft scheint Elektra die einzige zu sein, die sich ihre Ängste mit Gesprächsgruppen und anderen therapeutischen Angeboten nicht zu unterdrücken oder verarbeiten vermag. Stattdessen geht sie auf Konfrontationskurs – mit einem fatalen Ende.
Claus Guth inszeniert Elektra ganz im Spiegel seiner Entstehungszeit. Mit dem Aufkommen der Psychoanalyse, Sigmund Freuds Schriften zu Traumdeutung und frühkindlicher Persönlichkeitsprägung, aber auch der Blütezeit einer ebenso prominenten wie mysteriösen Krankheit, der Hysterie, die sich besonders bei jungen Frauen in unzähligen Symptomen äußerte. Abgerundet wird dies von C. G. Jungs Elektrakomplex, der diesen Begriff als Pendant zum Ödipuskomplex schuf, um so die übermäßige Bindung einer Tochter zu ihrem Vater zu erklären.
Eine dysfunktionale Familie, die langsam an sich selbst scheitert und zugrunde geht – statt komplexer Neudeutung entscheidet sich Guth, die Oper nah an der Partitur, jedoch mit wenig neuen, unverbrauchten Deutungsweisen zu erzählen. Er macht es sich recht einfach, wenn er seine üblichen Bilder und Symbole – großformatige, sich bewegende Wände, choreographierte Tänzer*innen, die elegant durchs Bild laufen, Kinder, die auf vergangene Traumata hinweisen – wie Zutaten in einen großen Topf wirft, umrührt und diese als tiefenpsychologische Neuproduktion präsentiert. Zu oft arbeitete Guth bereits in der Vergangenheit – auch an der Oper Frankfurt – mit dieser Bildsprache, als dass sie noch aufwühlt oder gar nachdenklich machen könnte.
Das Bühnenbild von Katrin Lea Tag mit den violetten Vorhangwänden und das effektiv eingesetzte Licht von Olaf Winter wirken modern und zeitgemäß, können jedoch nicht über offene Fragen von Guths Regie hinwegtäuschen, die einen Weg zwischen rachelüsternen Mordfantasien und humoresken Zwischenspielen suchen will. Sicherlich mutet Guths Ästhetik nach wie vor hochwertig an, die von ihm normalerweise gewohnte Tiefenpsychologie – hier sei an den phänomenalen Frankfurter Rosenkavalier erinnert – vermag er diesmal jedoch nicht präsentieren.
Aile Asszonyi, die bereits für Rollen wie die Färberin und Brünnhilde vorgesehen ist, debütierte in Frankfurt mit der mörderischen Titelrolle der Elektra und überzeugte bereits mit ersten Tönen durch ihre energiegeladene, voluminöse und hochdramatische Stimme. Auch szenisch konnte sie als traumatisierte Tochter Agamemnons, die mit störrischem Blick ihre Mitmenschen in Angst versetzt, den Raum mit maximaler Bühnenpräsenz bespielen. Asszonyi stellte eine Elektra dar, die vollumfänglich in Szene als auch Stimme den tiefenpsychologischen Wahnsinn ihrer Rolle vermitteln konnte. Susan Bullocks Klytämnestra strahlte Gelassenheit und gesangliche Überlegenheit aus. Ihre Interpretation war nicht überzeichnet, sie gestaltete ihre Rolle stattdessen mit versierter Zurückhaltung, deutlicher Deklamation und intelligenter Phrasierung. Jennifer Holloway traf als Chrysothemis alle Spitzentöne mühelos, ihre Stimme glühte voll Leidenschaft und Dramatik. Sie war eine ungewohnt selbstbewusste kleine Schwester der Elektra und stand stimmlich als auch in ihrer Darstellung auf einer Stufe mit Asszonyi. Der Orest von Kihwan Sim ertönte klangschön und markant, blieb jedoch im Ausdruck in seiner Gesamtdarstellung als Rächer des Agamemnos etwas zu verhalten, als dass er diese Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzen könnte.
Sebastian Weigle trieb das Frankfurter Opern- und Museumsorchester als versierter Strauss-Dirigent zu Höchstleistungen an. Während der Regisseur sich auf der Bühne in dezenter Zurückhaltung schmiegt, ließ Weigle das eigentliche Drama im Graben abspielen. Mit überaus packenden Kontrasten, komplexer Ausgestaltung und vielen Details schwang er sich in ruhigen Tempi mit imposanten, wohl dosierten Steigerungen, von einem musikalischen Höhepunkt zum nächsten.
Am Ende wird auf der Bühne gefeiert und getanzt. Die Bewohner*innen sind ausgelassen, die Stimmung gelöst – man nimmt es mit Humor. Das soll ja bekanntlich die beste Medizin sein. Elektra jedoch konnte es nicht retten – diese fällt zum Schluss entkräftet zu Boden und steht damit sinnbildlich für Claus Guths Neuproduktion. Diese konnte nur dank Weigle als scheidender Generalmusikdirektor und Asszonyi in der Titelrolle gerettet werden.